vom 3. Dezember 2015
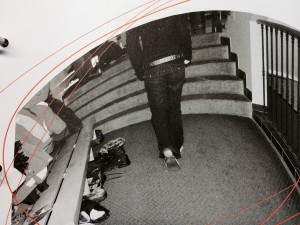
Bild: Grundlagen und Umsetzungshilfen für die Schulsozialarbeit in der Volksschule
Die Werkstattgruppe hat für den fünften Community-Anlass das Thema Menschenbilder vorbereitet und die Frage ins Zentrum gestellt, wo wir Menschenbilder in der Praxis der Schulsozialarbeit finden bzw. wie wir mit ihnen umgehen können.
Zum Einstieg ins Thema diente ein Gedanke aus dem Filmausschnitt der „Sternstunde Philosophie“ (SRF) mit Roland Reichenbach („Welche Schule brauchen wir?“ vom 28.6.2015), er weist darauf hin, dass „wenn die Dinge kompliziert sind, soll man diese Dinge angemessen berücksichtigen (…). Manche Argumente können nur deshalb überzeugen, weil sie ignorieren, dass die Dinge kompliziert sind. Da heisst es kindgerechte Schule, als ob klar wäre, was kindgerecht sei.“
Daran anschliessend klärte Herbert Meier (Dozent für den Fachbereich Soziale Arbeit) in seinem spannenden, fachlichen Input zu Menschenbildern Begrifflichkeiten und Zusammenhänge insbesondere zur Sozialen Arbeit bzw. der Schulsozialarbeit.
Anleitend für die Diskussion in Gruppen waren dann drei ausgewählte, in Schweizer Schulen gängige Leitsätze. Herbert Meier verfolgte die Gruppendiskussionen dann, und führte die Vielfalt der Diskussionsbeiträge in einem prägnanten Feedback zusammen, aus dem wir hier vier Gedanken festhalten möchten:
Eingebracht in die Diskussion wurde eine Frage, die ursprünglich ein Schüler einem Schulsozialarbeiter gestellt hatte: Ist der Mensch von Natur aus gut?
Herbert Meier kommentiert: Wenn wir diese Frage bejahen, können wir gar nicht fassen, was heute in der Welt vor sich geht. Geht es aber um die Frage, ist der Mensch nicht ausschliesslich gut, sondern ist er „offen“, das heisst, er kann sowohl gut sein, als auch destruktiv sein – dann ist man herausgefordert, differenziert hinzuschauen – mit anderen Worten: die Komplexität nicht zu ignorieren.
In allen Gruppendiskussionen zeichneten sich Spannungsfelder innerhalb der (Schul-) Organisationen ab. Dabei ging es um sogenannte „Modernisierungsparadoxien“, damit ist gemeint, dass im Alltag Widersprüchlichkeiten auftreten, denen man sich gar nicht entziehen kann. Ein Widerspruch besteht darin, dass es in einer Organisation sowohl Rahmenbedingungen braucht um gemeinsam Prozesse zu gestalten, ebenso wie Freiräume. Die Frage ist, wie dieser Widerspruch gestaltet wird. Es besteht eine Spannung zwischen der Festlegung von Abläufen und Interaktion – und den Freiräumen – die Austausch beinhalten, der nicht vorstrukturiert ist. Insbesondere wurde diskutiert, wie man mit Unterschiedlichkeit bzw. Individualität inmitten der vorgegebenen Strukturen umgehen kann.
Eine weitere Thematik bildete der Begriff des Lernens: Wie kann Lernen verstanden und entwickelt werden? Herbert Meier erklärte, dass Lernen eine notwendige Voraussetzung für Autonomie ist, aber nicht mit Autonomie selbst zu verwechseln sei. Sich Wissen anzueignen, ist eine notwendige Bedingung, um sich auch Autonomie anzueignen. Autonomie heisst hier entscheiden zu können, also Wissen zu bewerten. Dazu braucht es Fähigkeiten, die über die reine Reproduktion von Wissen hinausgehen.
Schliesslich zeigte sich noch ein weiterer Aspekt in der Diskussion um die Begrifflichkeiten: viele Alltags- (-bewältigungs-) -muster haben sich eingeschliffen, viele täglich verwendeten Begriffe sind so selbstverständlich, dass man sie lediglich über neue Zugänge zu Reflexion erschliessen kann. Zum Beispiel haben alle an Schule Beteiligten eine Vorstellung davon, was „schwierige Schüler“ sind. Zwar zeigt sich in der Realität ein ziemlich heterogenes Bild, trotzdem hat man den Eindruck von einer Selbstverständlichkeit, einem gemeinsamen Verständnis. Daher ist die Reflexion von Wahrnehmungen ein wichtiger Aspekt des professionellen Handelns, insbesondere dann, wenn die Soziale Arbeit wie in der Schule ständig mit der Individualität und Unterschiedlichkeit von Menschen konfrontiert ist.
Text: Johanna Brandstetter und Rosmarie Arnold.

