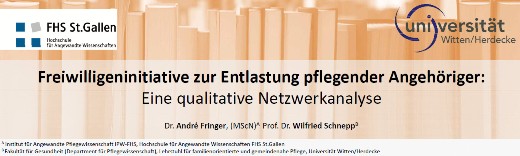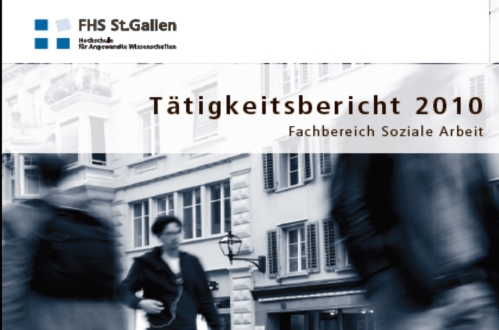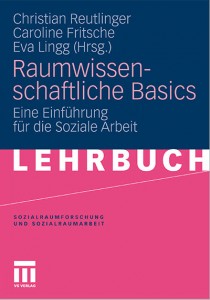Er wird auch von allen möglichen Seiten her vorgestellt – der rasch wachsende Neubau der St. Galler FHS direkt am Bahnhof. Was die Leader-Spezial-Ausgabe vom August 2011 aber vor allem interessant macht: wie der Neubau systematisch mit Blick auf seine Chancen für noch ausgeprägtere Interdisziplinarität beleuchtet wird. So kommt u.a. Prof. Dr. Ulrich Otto als Leuchtturmwärter des interdisziplinären Kompetenzzentrums CCG-FHS zu Wort, ausserdem die beiden Forscherinnen Prof. Dr. Sibylle Olbert sowie Dr. Petra Kugler vom Leuchtturmthema „Nachhaltige Unternehmensentwicklung“ – auch dies ein Schwerpunkt, in dem derzeit intensiv u.a. durch gleich mehrere F+E-Antragsprojekte die Synergien zum Generationenthema ausgelotet werden.
Archiv der Kategorie: Forschung
Posterpreis für FHSG-Wissenschaftler
Das IPW-FHS ist stolz auf ihn, das CCG-FHS gratuliert herzlich: An der wissenschaftlichen 3-Länderkonferenz Pflege und Pflegewissenschaft vom 18. – 20. September 2011 in Konstanz hat die Jury aus 41 eingereichten Postern jenes von Dr. André Fringer mit dem 2. Posterpreis prämiert. Sein Thema: Freiwilligeninitiativen zur Entlastung pflegender Angehöriger. Dies ist eine wertvolle Anerkennung seiner Thematik, die in der Schweiz zudem noch wenig erforscht ist.
André Fringer verstärkt erst seit kurzem das Forschungsteam der Pflege- und Gesundheitswissenschaften an der FHS St. Gallen – und erfreulicherweise zugleich das Kompetenzfeld Generationen- und Alternsforschung! Zum Posterthema hat er u.a. seine Dissertation zum Thema „Angehörigenpflege und Zivilgesellschaftlichkeit“ geschrieben, die auch als Buch erhältlich ist. Damit ergibt sich die aussergewöhnliche Situation, dass dies Thema an der FHS St. Gallen sowohl pflegewissenschaftlich (A. Fringer) wie von Seiten der Gerontologie bzw. Sozialen Arbeit (Prof. Dr. Ulrich Otto) kompetent und auf der Basis eigener empirischer und theoriebezogener Forschung vertreten ist. Otto selbst beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit (auch in der Altenhilfe und Pflege), in zwei der laufenden F+E-Projekte des CCG-FHS geht es ebenfalls darum.
Der Posterpreis ermutigt damit zugleich die FHSG-ForscherInnen, die an diesem gesellschaftlich besonders wichtigen, aber noch weithin verkannten bzw. auch tabuisierten Thema „dran“ sind, ihre Aktivitäten weiter zu verstärken.
KoAlFa – binationales F+E-Projekt gestartet (CCG)
Am 1. September haben die neuen beiden ProjektmitarbeiterInnen (Dr. Stefanie Richter und Theresa Hilse) ihre Arbeit aufgenommen – im Verbundprojekt der FH Jena (Prof. Dr. Michael Opielka) und des CCG der FHSG (Prof. Dr. Ulrich Otto): Das F+E-Projekt „Koproduktion im Welfare Mix der Altenarbeit und Familienhilfe (KoAlFa)“ zielt auf die Entwicklung und Erprobung neuer Methoden des Schnittstellenmanagements im Feld der multiprofessionellen und ehrenamtlichen Versorgung alter Menschen mit Demenz und ihrer pflegenden Angehörigen. Dabei gilt der Koproduktion informeller und formeller UnterstützerInnen sowie der multiprofessionelle Zusammenarbeit ein besonderes Interesse.
KoAlFa wird vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für drei Jahre (bis Juni 2014) im Schwerpunkt „Soziale Innovationen für die Lebensqualität im Alter“ – SILQUA gefördert. Diese Förderlinie des BMBF richtet sich an Fachhochschulen und initiiert versorgungs- bzw. praxisnahe Forschung zur Verbesserung der Lebensqualität, zur Erhaltung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung älterer, insbesondere von Alterserkrankungen betroffener Menschen.
Zur nachhaltigen Entwicklung und Gestaltung regionaler Versorgungsnetzwerke wird von Beginn an eine enge Zusammenarbeit zwischen WissenschaftlerInnen, VertreterInnen der professionellen Versorgung, der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagement sowie Betroffenen und Angehörigen angestrebt. Die im Forschungsprozess stattfindenden Austausch- und Aushandlungsprozesse sind Grundlage für gelingende Zusammenarbeit über die dreijährige Projektphase hinaus.
Zugleich fokussiert KoAlFa dabei auf die besondere Rolle der Sozialen Arbeit in sich koproduktiv gestaltenden Versorgungszusammenhängen und trägt durch eng verschränkte Forschung und Entwicklung zur Professionalisierungsdebatte bei.
Akademischer Nachwuchs in der Sozialen Arbeit
Am 8. September fand in Luzern eine Fachtagung zum Thema Akademischer Nachwuchs in der Sozialen Arbeit statt. Veranstalter war die Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit (SGSA).
Im Zentrum der Tagung standen der Austausch und die Diskussion der aktuellen Förderbedingungen von Personen, die in den Fachbereichen Sozialer Arbeit verschiedener Schweizer Fachhochschulen eine Dissertation schreiben. Die Tagung bot Raum, die aktuelle Situation zu diskutieren sowie Erwartungen und Wünsche zu formulieren.
IFSA-Tätigkeitsbericht zum Schwerpunkt Partizipation ist online
Corina Büchi, Studentin Studiengang Sozialarbeit. Wie Betroffene zu Beteiligten werden und wie Wissen gemeinsam von Expertinnen der Wissenschaft und Experten des eigenen Alltags erzeugt wird – in der Forschung, im Consulting, in der Weiterbildung und in der Lehre – zeigt der eben erschienene Tätigkeitsbericht anhand verschiedener Projekte auf. Dabei wird deutlich, dass Beteiligungsprozesse sorgfältige methodische Planung und Umsetzung erfordern.
Neues aF+E-Projekt zu „Koproduktität im welfare mix“
Es hat geklappt: das vom CCG-FHS (Prof. U. Otto) zusammen mit der FH Jena (Prof. M. Opielka) beantragte Silqua-Projekt “Koproduktivität im welfare mix der Altenarbeit und Familienhilfe” wird 2011-2014 gefördert.
Bei Silqua handelt es sich um ein grossformatiges Programm, mit dem innovative Alters- und Altenhilfeforschung an deutschen Fachhochschulen gefördert wird. Für die Alternsforschungs ist es eine mittlerweile durchaus renommierte deutsche FH-Förderlinie – in der nun schon dritten jährlichen Antragsrunde. Die Zugehörigkeit einer FHS zu den Silqua-Projekten markiert in Deutschland durchaus den engeren Kreis derjenigen, die mit einer Profilbildung in Sachen demografischer Wandel/ältere Menschen forschungsbasiert Ernst machen.
Die Projekte werden in einem hoch kompetitiven Bewilligungsverfahren geprüft: angesichts der niedrigen Bewilligungsquote von nur 29% in diesem Jahr liegt die Latte hoch: Jedes Projekt wird von drei (!) GutachterInnen nach aufwändigem 10-Dimensionen-Programm evaluiert, danach in bundesweiten Gutachtersitzungen diskutiert und nochmals gerankt.
Umso mehr freuen wir uns über den sehr guten – sechsten – Rangplatz: Bei 59 Projektanträgen wurden nur 17 gefördert, weitere 20 waren „prinzipiell förderwürdig“. Das Jena-St.Galler Kooperationsprojekt konnte sicher von Erfahrungen profitieren: Schon beim bereits laufenden Silqua-Projekt InnoWo (2009-2012) war es derselbe Rangplatz bei damals 80 eingereichten Anträgen.
Besonders freuen wir uns natürlich auch über unsere Rolle als Schweizer Partner-FHS im damit binationalen Projekt. Diese Konstellation ist sehr aussergewöhnlich, weil im Programm Silqua internationale Kooperation im Prinzip nicht vorgesehen ist und nur mit Blick auf das entsprechende einschlägige Forschungsstanding von den drei Gutachterpersonen – übereinstimmend – für wünschenswert erklärt wurde. Weiterlesen
Jetzt auch als gedrucktes Buch…
das dicke Handbuch Soziale Arbeit, mitsamt seinen aus dem Kreis der FHS St.Gallen beigesteuerten Beiträgen.
 Die Beiträge der FHS-MitarbeiterInnen:
Die Beiträge der FHS-MitarbeiterInnen:
- Bettina Grubenmann (zus. mit Thomas Gabriel): Soziale Arbeit in der Schweiz (>pre-print)
- Ulrich Otto: Soziale Netzwerke (>pre-print)
- Christian Reutlinger (zus. mit Fabian Kessl): Sozialraum (>pre-print)
Tagung „Wert(e) des Alters“ – Frankfurt-Reise vormerken!
Am 22. und 23.09.11 lohnt sich für gerontologisch Interessierte die Reise nach Frankfurt/Main: Eine Tagung unter dem Motto „Wert(e) des Alters“ soll sich einerseits mit ökonomischen und ethischen Aspekten des Alters und Alterns befassen, andererseits jedoch genug Raum lassen für Themen wie Technik, Arbeit, Lebensqualität, Pflege, das Lebensende u.a.m.
Durchgeführt wird die Tagung der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie (DGGG) als gemeinsame Jahrestagung der DGGG-Sektionen III und IV (III: „Sozial- und verhaltenswissenschaftliche Gerontologie“; IV: „Soziale Gerontologie und Altenarbeit“). Ein Schwerpunktthema der Sektion IV wird „Technik und Dienstleistungen für ältere Menschen“ sein. Ulrich Otto vom Kompetenzzentrum Generationen (CCG-FHS) der FHS St. Gallen organisiert sie als Vorstandsmitglied der Sektion IV mit.
Der erste Tag wird von beiden Sektionen gemeinsam gestaltet und ist vor allem sektionsübergreifenden Veranstaltungen, den Mitgliederversammlungen und einem Gesellschaftsabend gewidmet . Das Programm des zweiten Tages wird hingegen von beiden Sektionen separat verantwortet. In Kürze wird der zweite Call for Papers erfolgen und die Anmeldung (mit Frühbucherrabatt) freigeschaltet.
Fachtagung „Zuhause wohnen bis zuletzt“
So lange wie möglich selbstbestimmt zuhause wohnen bleiben, gar bis zuletzt – die überwältigende mittlerweile grenzüberschreitende Zustimmung macht schon fast misstrauisch. Zumindest gibt sie Anlass, wirklich genau hinzuschauen. Im binationalen F+E-Projekt „InnoWo – Zuhause wohnen bleiben bis zuletzt“ tun dies die kooperierenden Hochschulen FHS St. Gallen und HS Mannheim intensiv in der Forschung. Nun wollen sie die Fragen auf einer gemeinsamen Tagung in Mannheim (16.05.2011) fachöffentlich diskutieren:
- welche Probleme treten dabei auf?
- können auch demenzkranke Menschen zu hause bleiben?
- welche Risiken und Chancen gibt es?
- wie kann die Lebensqualität älterer Menschen gesichert werden, wie die der Pflegenden?
- was kann moderne Technik (AAL) dazu beitragen?
- wie ist die Forschungslage?
Nehmen wir „Ambulant vor stationär“ und „ageing in place“ nicht als wohlfeile Label sondern als wirklich nachhaltige Leitorientierungen in den Blick, so zeigt sich, wie anspruchsvoll sie sind. Schauen wir detaillierter hin, trägt auch die oberflächliche Einigkeit möglicherweise nicht weit. Denn es braucht noch erhebliche Anstrengungen, wenn es für immer mehr Menschen ermöglicht werden soll: zuhause wohnen bleiben zu können bis zuletzt – in möglichst hoher Selbstbestimmung und guter Lebensqualität für die direkt Beteiligten und ihre Netzwerkpersonen.
Dies ist mittlerweile einer der Forschungs- und Consultingschwerpunkte des Kompetenzzentrums Generationen (CCG-FHS), die Frage nach dem assistiven Beitrag moderner Technik zum Independent Living Älterer wird u.a. im Kompetenzzentrum AAL des Innovationszentrums IZSG bearbeitet. Prof. Ulrich Otto wird in seinem Vortrag auf der Tagung einschlägige Ergebnisse des F+E-Projekts InnoWo einbringen.
Soziale Rendite auf Partizipation?
Beispiele aus Forschung und Entwicklung im Feld kontextuierten Wohnens Älterer
Wohnen wird mehr und mehr als eines der „Top-Themen alternder Gesellschaften“ erkannt. Das ist aus Sicht sowohl der Gerontologie als auch der Sozialen Altenarbeit eine chancenreiche Fokussierung – gerade wenn Wohnen im Älterwerden als „Wohnen im Kontext“, als eingebettetes Wohnen im Quartier, in sozialen Räumen und sozialen Netzwerken begriffen wird. Partizipation spielt dabei eine wichtige Rolle.
Mit Fokus Wohnen weg vom Versorgungs- hin zum Partizipationsleitbild
Warum chancenreich? der Wohnfokus kann einerseits heraus führen aus der Verengung der öffentlichen und professionellen Debatte auf Versorgung und Pflege. Andererseits bietet er auch für diesen Bereich eine herausfordernde Leitidee – das Wohnen in der Pflege bzw. Pflege im Wohnen. (vgl. Aufsatz Otto, 2010)
Deshalb setzen wir im Kompetenzzentrum Generationen (CCG-FHS) gleich mit mehreren F+E-Projekten auch am Thema Wohnen an, meist interdisziplinär, meist lebenslaufbezogen, im produktiven Austausch mit dem Kompetenzzentrum Soziale Räume (SR-FHS):
- Etwa mit Consulting- bzw. F+E-Projekten, die innovative Wohnformen sowie quartiersorientiertes Wohnen fördern und genauer untersuchen,
- mit interdisziplinären Projekten, die soziale und technische Assistenz, neue Technologien und soziales Umfeld zusammenbringen wollen mit dem gleichen Ziel – ambient assisted living.
Stellvertretend für die CCG-Forschungsaktivitäten schauen wir nur ein Projekt genauer an: Das binationale Projekt „InnoWo“ buchstabiert Partizipation mehrdimensional in einer der schwersten Alterssituationen konsequent aus – Ziel ist das Zuhause wohnen bleiben können bis zum Schluss in drei innovativen Settings:
Soziale Nachbarschaften in der Bodenseeregion
Das Projekt „Soziale Nachbarschaften – Schlüsselfaktor einer Regionalentwicklung“, welches unter der Federführung des Kompetenzzentrums Soziale Räume gemeinsam mit ProjektpartnerInnen der Hochschulen Rapperswil und Vorarlberg sowie der Universität Liechtenstein letzten Sommer eingereicht wurde, wurde bewilligt!
Ein grosses Standardwerk der Sozialen Arbeit – völlig neu!
Das neue „Handbuch Soziale Arbeit“ ist lange angekündigt worden – zumindest die pre-prints stehen nun vorab elektronisch zur Verfügung.
In gedruckter Form wird das von Hans-Uwe Otto und Hans Thiersch herausgegebene Werk erst im Mai 2011 erscheinen. Das AutorInnenverzeichnis liest sich wie das „who is who“ der deutschsprachigen wissenschaftlichen Sozialen Arbeit und Sozialpädagogik – die FHS St. Gallen ist mit drei Artikeln (s.u.) gut vertreten. Zum Gesamtwerk:
- über 175 Beiträge zu den zentralen Themen des Fachs
- rund 200 Autoren auf mehr als 1.800 Seiten
- Themen von A wie „Abweichendes Verhalten“, bis Z wie „Zivilgesellschaft“
- komplett überarbeitet und zahlreiche neu aufgenommene Beiträge
Die Beiträge der FHS-MitarbeiterInnen:
- Bettina Grubenmann (zus. mit Thomas Gabriel): Soziale Arbeit in der Schweiz (>pre-print)
- Ulrich Otto: Soziale Netzwerke (>pre-print)
- Christian Reutlinger (zus. mit Fabian Kessl): Sozialraum (>pre-print)
Schnittstellenmanagement – 2-Länder-F+E-Antrag in Endrunde?
Die Vorauswahl hat es immerhin schon bestanden – ein kürzlich beantragtes F+E-Projekt des CCG. Ulrich Otto hat es zusammen mit Prof. Dr. Michael Opielka von der FH Jena entwickelt und im deutschen Programm Silqua 2011 eingegeben – einem DORE-ähnlichen Programm des deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Nun wird es spannend, ob es in dem hoch kompetitiven Verfahren bewilligt wird.
Doch zu den Inhalten: zugegeben – es gibt handlichere Titel als „Koproduktivität im welfare mix der Altenarbeit und Familienhilfe“. Was ist damit gemeint? Neue Methoden des Schnittstellenmanagements sollen erforscht, erprobt und etabliert werden. Schnittstellenmanagement zwischen professionellen bzw. beruflichen sozialen Diensten und Unterstützungsleistungen informeller Netzwerke im Feld der Alten- und Familienhilfe – damit will das geplante Forschungs F+E-Projekt einen Beitrag leisten , die Lebensqualität, Selbständigkeit und Würde älterer Menschen zu wahren und zu verbessern.
Hauptzielgruppen des Projekts sind an Altersdemenz erkrankte Menschen und deren Angehörige sowie professionell-berufliche, semi-professionelle und bürgerschaftliche HelferInnen. Im Projekt sind F- und E-Aspekte eng miteinander verschränkt. Es soll gezeigt werden, wie optimale Strukturen und Praxen des Schnittstellenmanagements im welfare mix koproduktiv gestaltet werden können.
Publikation: Raumwissenschaftliche Basics

Auseinandersetzungen mit Raum nehmen in den Sozial- und Erziehungswissenschaften inzwischen eine prominente Rolle ein. Die wissenschaftlichen Diskurse oder die dominierenden ‚Reden vom Raum‘ gehen auch mit einer veränderten Praxis einher, die sich z.B. in der Sozialen Arbeit in der Formel ‚vom Fall zum Feld‘ zuspitzt…
Das Verhältnis von Sozialpädagogik und Altersthemen…
…ist in vieler Hinsicht unklar. Dies gilt – bei allen Unterschieden – im gesamten deutschsprachigen Raum.
- Wie steht es mit der Sozialpädagogik im Konzert der Altersthematisierungen: Tatsächlich wird in weiten Teilen der wissenschaftlichen sozialen Gerontologie der Beitrag der Disziplin Sozialer Arbeit respektive Sozialpädagogik tendenziell übersehen oder deutlich unterschätzt. Selbst in explizit interdisziplinären Foren und Diskursen der Gerontologie ist sie oft nicht dabei.
- Und wie steht es mit Alternsthemen im Konzert sozialpädagogischer Diskurse? Im Selbstverständnis der Profession und der praktischen Sozialen Arbeit scheint die Soziale Altenarbeit noch immer randständig. Weder die Orientierungen an Übergängen, noch an Biografie und Lebenslauf oder kritischen Lebensereignissen und dem Belastungs-Bewältigungs-Paradigma hat zu einer weitergehenden Orientierung am gesamten Lebenslauf unter Einschluss des hohen und höheren Alters geführt.
Diese Situation ist unbefriedigend. Sie wird der demografischen Herausforderung nicht gerecht, sie „verschenkt“ theoretische, empirische und konzeptions-, handlungs- und methodenorientierte Wissens- und Lernmöglichkeiten – in Richtung Alternswissenschaften (und angewandter Gerontologie) und in Richtung Soziale Arbeit. Vor diesem Hintergrund ist es sehr erfreulich, dass in jüngster Zeit einige einschlägige Bände im weiteren Kontext der Sozialen Altenarbeit erschienen sind.
Ganz aktuell ist ein fast 600-seitiger Herausgeberband aus Österreich von Gerald Knapp und Helmut Spitzer: