Das Institut Soziale Arbeit (IFSA-FHS) sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Leiterin/Leiter (80%) des Forschungsschwerpunktes «Arbeit und Integration». Weiterlesen


Das Institut Soziale Arbeit (IFSA-FHS) sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Leiterin/Leiter (80%) des Forschungsschwerpunktes «Arbeit und Integration». Weiterlesen
Der Vorplatz der FHS St.Gallen hat gestern Nachmittag, 26.8., ein paar Farbtupfer erhalten: Kinder haben zu Pinsel und Farbe gegriffen und auf einer Papierrolle ihre Sicht der Welt aufgemalt.
Das Institut für Soziale Arbeit an der FHS St.Gallen konnte verschiedene Kinderkrippen, Tagesbetreuungen und Primarschulen in der Ostschweiz gewinnen, ähnliche Malaktionen durchzuführen. Die Ergebnisse werden an der Fachtagung „Kinderwelten auf der Spur“ am 24. September 2015 gezeigt.
Am Dienstag geniesst das IFSA-Team einen Ausflug ins Grüne: Bei der Führung im Botanischen Garten steht der Efeu im Mittelpunkt, beim anschliessenden Pick Nick im Tropenhaus ein feines Buffet… Weiterlesen
Wie sieht ein „kinderfreundliches“ Aufwachsen auf? Welche Förderung sollen Kinder erhalten und wie sehen die Bedürfnisse und Perspektiven der Kinder selbst aus? Weiterlesen
Wie gestalten Jugendarbeitende die Treffpunkte von Jugendlichen als „pädagogische Orte“? Wie beziehen Jugendarbeitende Raumaspekte in ihr professionelles Handeln ein?
Zu diesen Fragestellungen forschen wir am IFSA seit 1. Mai diesen Jahres im Projekt „Praktiken pädagogischer Ortsgestaltung. Eine ethnographische Studie im sozialpädagogischen Feld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (kurz: Porta OKJA)“. Die Projektleitung hat Prof. Dr. Christian Reutlinger inne, zum Projektteam an der FHS gehören Ulrike Hüllemann, Bettina Brüschweiler und Michela Nussio. In einer ethnographischen Studie möchten wir herausfinden, wie Jugendarbeitende pädagogische Orte gestalten und Raumaspekte in ihr pädagogisches Handeln einbeziehen. Die Projektlaufzeit beträgt 2.5 Jahre, geplanter Projektabschluss ist Ende Oktober 2016. Finanziert wird das Forschungsprojekt vom Schweizerischen Nationalfonds in der Kategorie „anwendungsorientierte Grundlagenforschung“.
Kurzinformation zum Projekt: In den letzten Jahren werden Raumbegriffe verstärkt in den Fachdiskurs der Sozialen Arbeit aufgenommen und professionelles Handeln richtet sich zunehmend an räumlichen Einheiten aus. Im Zuge dieses Raumthematisierungsbooms wird Raum meist als „Behälter“ gedacht, was die Gefahr birgt, dass soziale Prozesse und deren Zusammenspiel mit räumlichen Bedingungen nicht oder nur verkürzt dargestellt werden. Dem gegenüber existieren in einigen Feldern der Sozialen Arbeit wie der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) auch Ansätze, die – z.B. mit dem Ziel der Förderung von Aneignungsprozessen – materielle wie auch soziale Aspekte von Raum in pädagogisches Handeln einbeziehen. Bisher gibt es allerdings noch keine empirischen Erkenntnisse darüber, wie in der offenen Kinder- und Jugendarbeit ganz konkret „mit dem Ort“ gearbeitet wird und welche (Aneignungs-)Räume für Jugendliche dadurch geschaffen werden können. Diese Leerstelle versuchen wir mit dem Projekt zu schliessen.
Lebensqualität ist mehr als Glück, Zufriedenheit, Wohlfahrt, Wohlbefinden, Lebensstandard und wie die Begriffe zu „Güteklassen von Lebenswahrnehmung“ sonst noch in Erscheinung treten mögen. Zusätzlich spannend wird es, wenn die Dimension „Gemeinde“ hinzukommt. Wie „gut“ oder „schlecht“ lebt es sich in Bezug zur Gemeinde?
Weiterlesen
Während der Arbeitszeit einen Arzttermin für die kranke Mutter organisieren, am Fussballspiel des Sohnes mit einem Geschäftspartner telefonieren und beim Joggen auf die Lösung für ein Arbeitsproblem kommen – viele Berufstätige wechseln ständig zwischen Beruf, Familie und Freizeit hin und her. Die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit ist für viele Menschen eine grosse Herausforderung und wird vor allem im Hinblick auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft diskutiert. Das Institut für Soziale Arbeit an der Fachhochschule St.Gallen (IFSA-FHS) verfolgt mit dem Impulsprojekt „Switchen ist legitim“ nun eine neue Perspektive: Es stellt die Männer ins Zentrum der Vereinbarkeitsthematik.
Im Projekt wird untersucht, wie häufig Männer zwischen Kontexten von Beruf, Familie und Freizeit wechseln und ob sie dies in der Arbeitswelt „verdecken“. Ziel ist es, einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit zu leisten. Die Fachhochschule sucht Männer aus der Ostschweiz, die bereit sind, online einen Fragebogen zum Thema auszufüllen: switchen-ist-legitim.ch
Gute und liebevolle Sorge – das wünschen sich Kinder und Erwachsene, die Betreuung und Pflege brauchen. Zeit, Geld und Unterstützung – das wünschen sich Personen, die in der Betreuung und Fürsorge engagiert sind. Diesen Ansprüchen gerecht zur werden und sie zu finanzieren wird immer schwieriger. Trotz des grossen Engagements speziell von Frauen, des Ausbaus der öffentlichen Angebote und der Anstellung von Dienstleisterinnen in immer mehr Privathaushalten wird für viele Menschen eine Versorgungslücke spürbar.
Care-Lücken stellen für unsere Gesellschaft ein ernstzunehmendes Problem dar. Wie können wir ihnen begegnen? Welche Versorgungsmodelle möchten wir für unsere Zukunft? Wie können wir die Qualität von neuen, bezahlbaren und flexiblen Care-Angeboten weiterentwickeln und Care-Arbeit aufwerten, gerechter verteilen und professionalisieren? Wie können wir aus der Konkurrenz zwischen privater und öffentlicher Versorgung ein konstruktives Zusammenspiel entwickeln? Wie würde die Care-Landschaft aussehen, wenn wir sie auf der grünen Wiese nochmal neu gestalten könnten?
Ausgehend von Ergebnissen des Forschungsprojektes «Care»-Trends in Privathaushalten, das Nadia Baghdadi, Bettina Brüschweiler, Raphaela Hettlage und Annegret Wigger erarbeitet haben, ist das Ziel der Tagung Szenarien alternativer Versorgungsmodelle zu entwickeln. Die Tagung bietet sowohl Raum, Visionen zu entwickeln als auch konkrete Lösungen in einzelnen Teilbereichen zu erarbeiten. Ausserdem ermöglicht sie die Vernetzung unterschiedlicher Interessensgruppen.
Die Tagung findet am Donnerstag, 22. Mai 2014 von 13.30 bis 17.30 an der FHS St.Gallen statt.
Weitere Informationen finden Sie am Flyer.
Direkt anmelden können Sie sich hier.
Über den aktuellen Projektstand, Links und bisherige Publikationen können Sie sich aktuell auf der Seite der Gebert Rüf Stiftung informieren. Unsere neue Publikation basierend auf den Vorträgen und Diskussionen des 1. St.Galler Abends, der als Kick-off-Veranstaltung die Anfangsphase unseres Projekts markierte, erscheint demnächst, unser IFSA-Blog hält Sie auf dem Laufenden.
Als Folge unterschiedlicher Vernetzungsaktivitäten konnten seitdem weitere Kooperationen entstehen – so waren wir am 19.1.2014 Gastgeber der Dialogveranstaltung zum Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Gemeinsam mit der Trägerschaft des Orientierungsrahmens (dem Netzwerk Kinderbetreuung sowie der Schweizerischen UNESCO-Kommission) diskutierten wir mit Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Hochschulen, Zivilgesellschaft und Betreuungspraxis das Thema „Kindsein im Sozialen Raum – Bedingungen des Aufwachsens aus der Perspektive des Orientierungsrahmens“. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie hier.
Aus aktuellem Anlass möchten wir ausserdem auf ein gelungenes Projekt der Bildungsdirektion des Kantons Zürich aufmerksam machen. Die Perspektive der Kinder und Jugendlichen, ihre Bildungsräume und Lerngelegenheiten haben die Verantwortlichen eindrucksvoll in 40 Kurzfilmen dokumentiert und veröffentlicht. Unter dem Titel „Ich sehe was – was siehst du?“ erhalten Sie Einblicke in das Leben der Kinder bis 4, weiterführende Fachkommentare und Material steht ebenso zur Verfügung: http://www.kinder-4.ch/de/home
Die Buchreihe „Soziale Räume – Perspektiven, Prozesse, Praktiken“ zeigt Arbeiten des Kompetenzzentrum Soziale Räume, welche sich in ganz unterschiedlichen Kontexten mit sozialräumlichen Fragestellungen beschäftigen. In dieser Reihe werden zukünftig Monographien, Studien und Berichte, Arbeitsmaterialien, Studienunterlagen und Sammlungen zu den thematischen Schwerpunkten des Kompetenzzentrums erscheinen.


Im ersten Band „Hoch hinaus und inmitten der Stadt“ widmet sich Eva Lingg der Planungsgeschichte der FHS St.Gallen am Bahnhof Nord. Wie kam es zur Standortentscheidung? Wer war am Planungsprozess beteiligt? Und wie fand die FHS St.Gallen, so wie sie sich uns heute präsentiert, ihre spezifische Form? Der Text ist ein Auszug ihrer Dissertation, welche sich dem Thema der Planungsprozesse im Hochschulbildungsbereich widmet. Im Zentrum stehen die verschiedenen Gestaltungslogiken der an Planung beteiligten Akteure und wie diese in Planungsprozessen zusammen gebracht werden können.
Bettina Brüschweiler beschäftigt sich im Band 2 mit der „Rede von KinderRäumen“. Analysiert wird ein bestimmter Diskursausschnitt dieser Rede von KinderRäumen, indem die vorhandenen Deutungsmuster der Themenelemente Kinder und Raum im schweizerischen Fachdiskurs der Sozialen Arbeit genauer betrachtet werden. Dabei werden Konsequenzen für professionelle Praxen der Sozialen Arbeit abgeleitet. Der Text basiert auf der Master-Thesis-Arbeit der Autorin und ist nun in leicht gekürzter und überarbeiteter Form erschienen.
Beide Publikationen können nun bestellt werden bzw. ist der zweite Band auch als EBook erhältlich: http://www.fhsg.ch/fhs.nsf/de/ifsa-fhs-forschungsschwerpunkte-publikationen-soziale-raeume
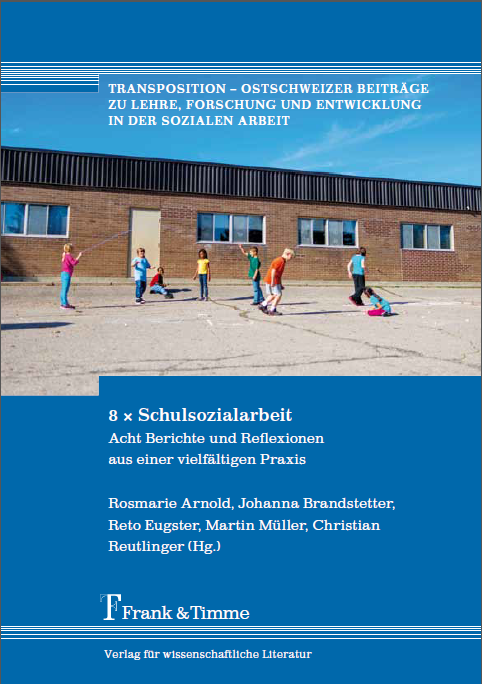
Nach einer intensiven Arbeitsphase ist es soweit: Mit dem Buch „8 x Schulsozialarbeit“ erscheint ein brandneuer Diskussionsbeitrag rund um die Entwicklung und Professionalisierung der Schulsozialarbeit. Dieses Berufsfeld der Sozialen Arbeit hat sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt. Die Mitglieder der Herausgeberschaft aus Lehre, Weiterbildung, Consulting wie Forschung und Entwicklung an der FHS St.Gallen haben während der letzten Jahre unterschiedliche Facetten der Schulsozialarbeit beobachtet und bearbeitet (siehe auch www.bildungshorizont.ch) und mit dieser Publikation Akteure ins Zentrum geholt, die bisher kaum Raum und Stimme im Diskurs erhalten haben: Vertreterinnen und Vertreter der Praxis.
8 Schulsozialarbeitende aus Ostschweizer Kantonen haben sich bereit erklärt, einen Einblick in ihre Berufspraxis zu gewähren. Sie haben jeweils einen Praxisbericht erarbeitet, reflektierten ihre Erfahrungen und Einschätzungen und gingen in den Dialog mit einem ihrer Mitautoren. Die unterschiedlichen Organisationsmodelle, Aufgabenportfolios und Begrifflichkeiten zeugen von ihren Wegen, meist geprägt von lokalen Besonderheiten und Konstellationen, in denen professionsfremde Akteure eine wichtige Rolle spielen.
Die Herausgeberschaft hat schliesslich die Fäden noch einmal zusammengeführt: ihr Fazit bietet eine kritische Betrachtung, vor allem aber schärft es weiterführende Stränge zur Diskussion: Welche Vor- und Nachteile birgt das Fehlen von Ansätzen zu einer gemeinsamen theoretischen Fundierung? Wird die Schulsozialarbeit eine eigene Expertise ausbilden? Oder läuft sie Gefahr, sich von anderen Logiken vereinnahmen zu lassen?
Weiterlesen über die Schulsozialarbeit der Ostschweiz können Sie direkt im Buch, es erscheint bei Frank und Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur in der Reihe Transposition – Ostschweizer Beiträge zu Lehre, Forschung und Entwicklung in der Sozialen Arbeit. Weitere Details und Buchbestellung über den Flyer bzw. direkt über den Buchhandel.
Direkt Hineinhören in die Fachgespräche der Schulsozialarbeitenden können Sie auf der Homepage der FHS St.Gallen, wo vier Podcasts zum Anhören bereit stehen: www.fhsg.ch/8xschulsozialarbeit
Es war eine gut besuchte und liebevoll ausgerichtete Tagung, voller interessanter BesucherInnen und mit spannenden Referaten und vielseitigen Arbeits- und Diskussionsformen: Der Workshop der Walder-Stiftung „Generationsübergreifende Wohnformen“ in Winterthur Ende 2013. Die FHS war nicht nur mit Referaten von Ulrich Otto (CCG-FHS; ab Sept. 2014 Leiter Careum Forschung, Zürich) und Sonya Kuchen (IFSA-C), sondern auch noch mit einer Reihe von Kooperationspartnerinnen indirekt vertreten, mit denen beide in F+E- und Consulting-Projekten zusammenarbeiten.
 Die Broschüre kann kostenlos bei der Walderstiftung bestellt werden und steht zum download bereit:
Die Broschüre kann kostenlos bei der Walderstiftung bestellt werden und steht zum download bereit:
Die Unterstützung pflegender Angehöriger, die für Ältere in ihrer eigenen Häuslichkeit sorgen, rückt immer mehr in den Brennpunkt des öffentlichen Interesses. Dabei wird fast überall – in den Diensten, den Gemeinden und Städten, der Öffentlichkeit allgemein – davon ausgegangen, dass diese wichtige Aufgabe nur funktionieren kann mit Unterstützung durch Ehrenamtliche bzw. Bürgerschaftlich Engagierte. Was aber machen eigentlich Freiwillig Engagierte in diesem herausfordernden Arbeitsfeld ganz konkret? Und welche Bedeutung haben die Tätigkeiten für die Freiwilligen? Diese Frage diskutiert eine Mixed-Methods-Studie – die sehr differenziert die unterschiedlichen Ausprägungen von Sozialer Unterstützung (social support) nachzuzeichnen versucht.
 Auf dem Schweizerischen Gerontologiekongress in Fribourg 2014 hat das Poster zu dieser Forschung nun den dritten Posterpreis erhalten. Es wurde von dem interdisziplinären Team von Prof. Dr. André Fringer (Pflegewissenschaft, Projektleitung) und Prof. Dr. Ulrich Otto (Gerontologie und Soziale Arbeit; ab 2014 Leiter Careum Forschung, Zürich) präsentiert. Und zwar im Rahmen einer von ihnen gemeinsam geleiteten interdisziplinären Postergruppe – auch dies ein eher seltenes Novum, aber bezeichnend für die FHS St. Gallen.
Auf dem Schweizerischen Gerontologiekongress in Fribourg 2014 hat das Poster zu dieser Forschung nun den dritten Posterpreis erhalten. Es wurde von dem interdisziplinären Team von Prof. Dr. André Fringer (Pflegewissenschaft, Projektleitung) und Prof. Dr. Ulrich Otto (Gerontologie und Soziale Arbeit; ab 2014 Leiter Careum Forschung, Zürich) präsentiert. Und zwar im Rahmen einer von ihnen gemeinsam geleiteten interdisziplinären Postergruppe – auch dies ein eher seltenes Novum, aber bezeichnend für die FHS St. Gallen.
Orientierungsschwierigkeiten oder Angst vorm Stürzen können mit zunehmendem Alter der Grund für eine Einschränkung der körperlichen Aktivität sein. Daher hat sich das Projekt DOSSy (Digital Outdoor and Safety System) zum Ziel gesetzt, eine App speziell für ältere Menschen zu entwickeln, um diesem Problem entgegenzuwirken.
Die Smartphone- und Tablet-Applikation zielt darauf ab, die Mobilität, Gesundheit und Lebensqualität älterer Menschen zu fördern. DOSSy soll ein helfender Begleiter bei Outdoor-Aktivitäten sein. Einerseits bietet die App Orientierungshilfen. Andererseits sollen auch Sicherheitsfunktionen für die/den NutzerIn leicht zugänglich sein, wie beispielsweise durch einen Notrufknopf oder ein passives Überwachungssystem. DOSSy ist mit einer Notruf-Zentrale verbunden, welche in kritischen Situationen die GPS-Daten des Standortes der/s App-Nutzerin/s zugesandt bekommt, um eine Ortung zu erleichtern und eine Rettungsmassnahme schnellstmöglich durchführen zu können.
Eine bedarfsgerechte und zielgruppennahe Entwicklung von DOSSy wird als kritischer Erfolgsfaktor angesehen. Daher übernimmt das Kompetenzzentrum für Ambient Assisted Living der FHS St. Gallen unter der Leitung von Beda Meienberger die Aufgabe, die älteren Menschen frühzeitig in die Entwicklung der App einzubinden. Dies wird in enger Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Generationen (CCG) durch die Mitarbeit von Marlene Brettenhofer umgesetzt. Die ersten Feldtests mit Outdoor-Begeisterten SeniorInnen im Alter von bis zu 90 Jahren (!) wurden bereits im Schweizer Engadin sowie in der süddeutschen Chiemsee-Region durchgeführt.
An dem multinationalen Projekt beteiligen sich Partner aus der Schweiz, Deutschland und England. Die Universität St. Gallen nimmt die Gesamtkoordination des Projektes wahr. Neben der Fachhochschule St. Gallen beteiligen sich auch die Curena AG (Schweizer Betreiber einer Notruf- und Service-Zentrale), der Schweizer Alpen Club, Augmentra Ltd. (britischer App-Anbieter für Aktivitäten in der freien Natur), der Bergverlag Rother (Verlag für Wanderführer und Outdoor-Literatur) und das Deutsche Rote Kreuz Herten (Träger der grössten Notrufzentrale Deutschlands).
Das Projekt wird zum Teil durch das Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP) der Europäischen Kommission finanziert.
Mehr über DOSSy erfahren Sie hier …
E-mail-gestützte Onlineberatung bietet das UniversitätsSpital Zürich bereits seit einigen Jahren an – und hat dabei nicht nur umfangreichste praktische – und grossenteils sehr positiv bewertete – Beratungserfahrungen gesammelt, sondern zugleich vielfältige Forschungsfragen bearbeitet. Nun wollen die USZ-Telemedizin-ExpertInnen PD Dr. med. Christiane Brockes-Bracht und Dr. Sabine Schmidt-Weitmann die Teleberatung um die Kanäle Vedio, Telefon und Vitaldaten-Telemonitoring ergänzen.
Und zwar zuunächst für die besonders grosse und herausfordernde Zielgruppe der älteren Menschen. Zu diesem Zweck haben sie sich sowohl mit einigen Unternehmen – vor allem aus dem IT-Bereich – zusammengetan als auch mit mehreren Experten der FHS St. Gallen.
Zusammen haben sie jetzt ein umfangreiches interdisziplinäres F+E-Projekt namens „Medizinisches Telemonitoring plus individuelle Teleberatung auf Basis eines AAL-Assistenten – eine interdisziplinär-integrierte Innovation“. Es wird zwei Jahre lang von der KTI gefördert, die Unternehmenspartner bringen ausserdem umfangreiche Eigenleistungen ein.
Die wesentlichen interdisziplinären „Deliverables“ des Projektes sind:
Sowohl für die technologische Innovationsproblematik wie auch für die sozialwissenschaftlichen Aspekte wurden an der FHS St. Gallen, die ja systematisch auf Interdisziplinarität setzt, einschlägige Experten gewonnen: das Kompetenzzentrum Ambient Assisted Living (AAL) mit dessen Leiter Beda Meienberger sowie das interdisziplinäre Kompetenzzentrum Generationen (CCG-FHS) mit dessen Leiter, dem Gerontologen Prof. Dr. Ulrich Otto (ab Sept. 2014 Leiter Careum Forschung, Zürich) sowie Silvan Tarnutzer (Soziologie) und Marlene Brettenhofer (Public Health)